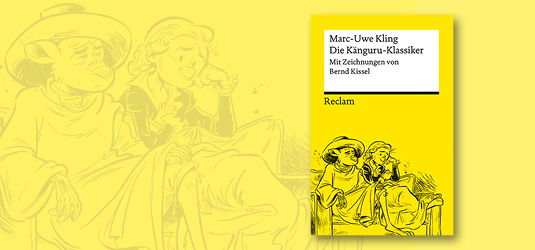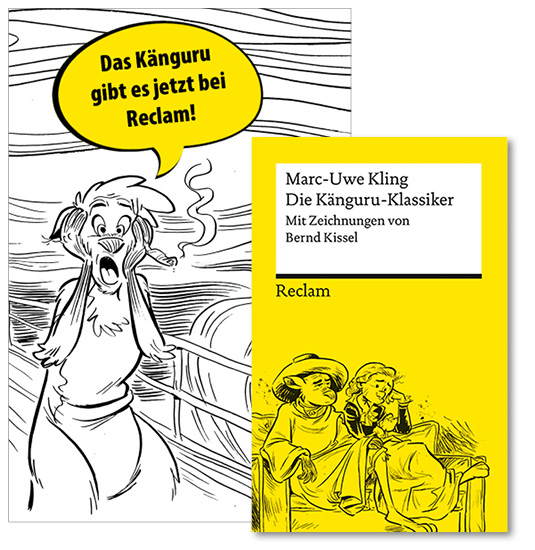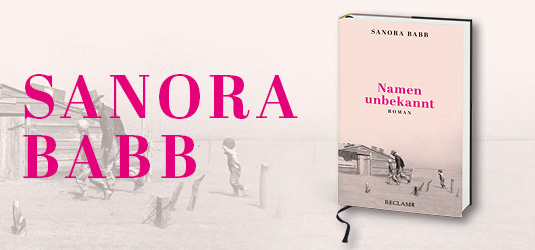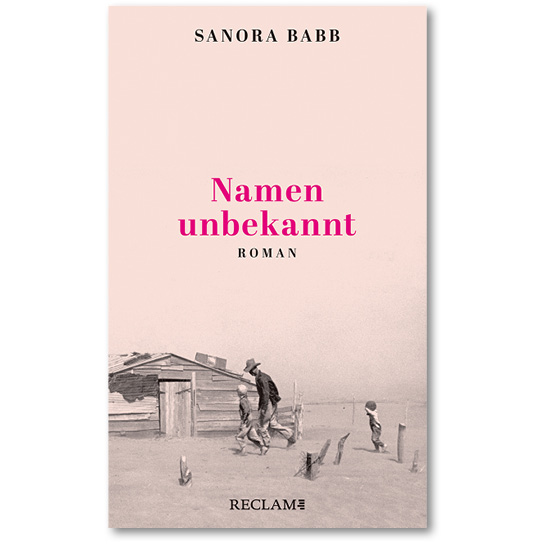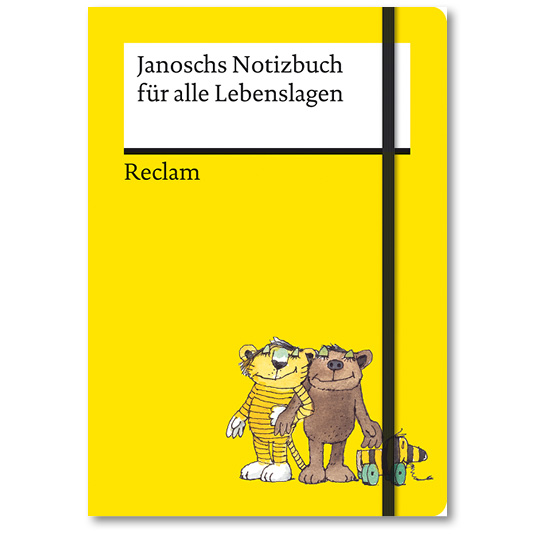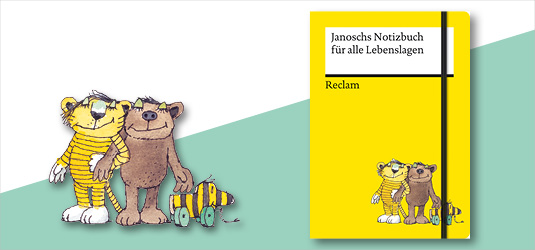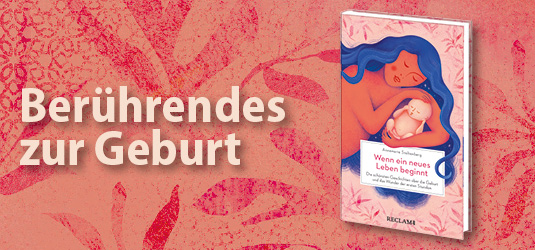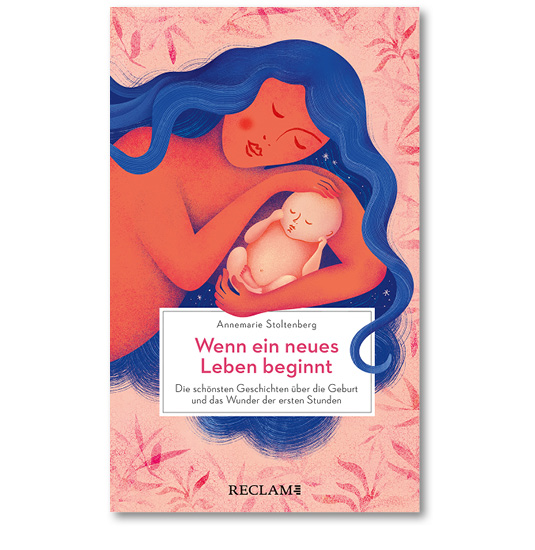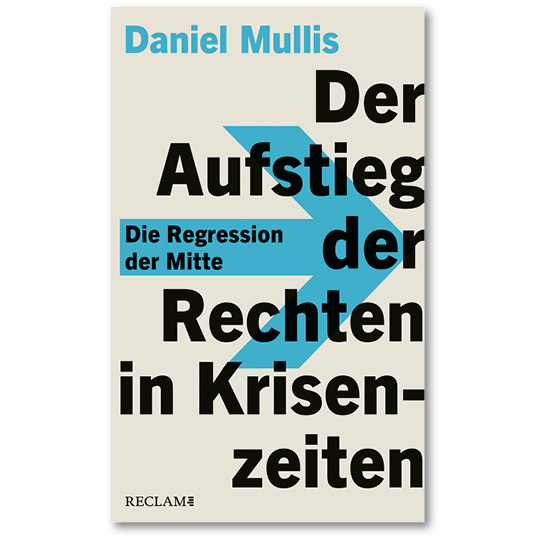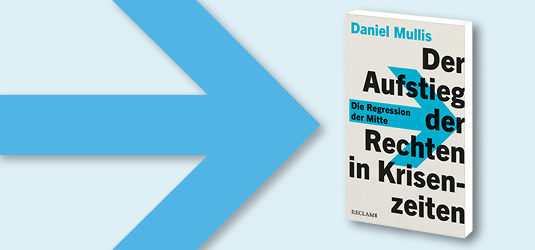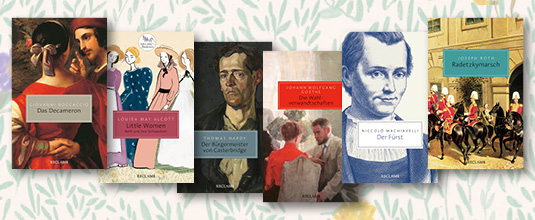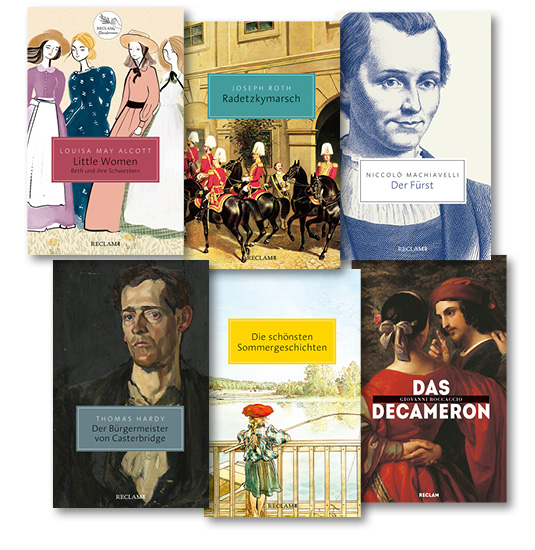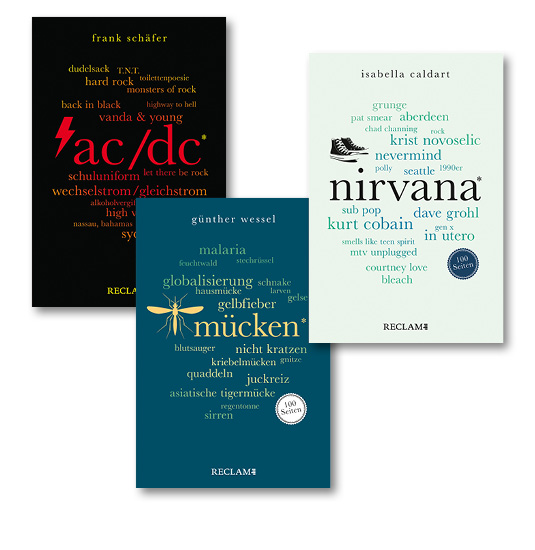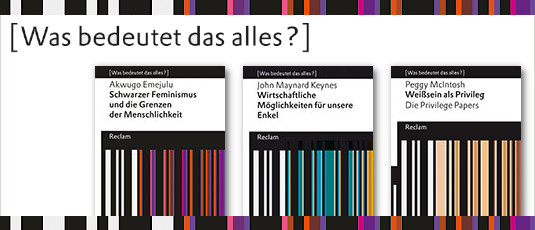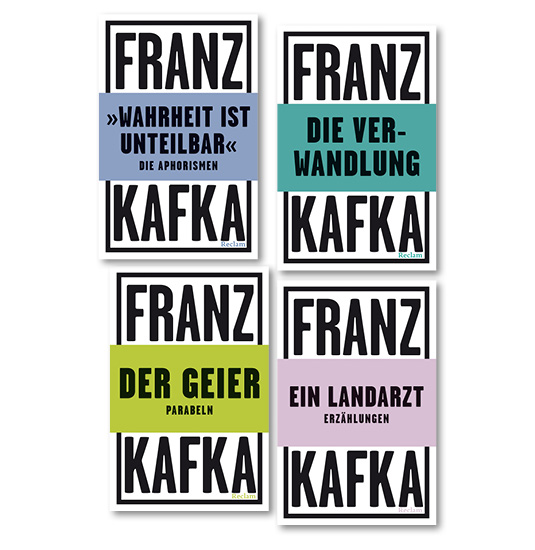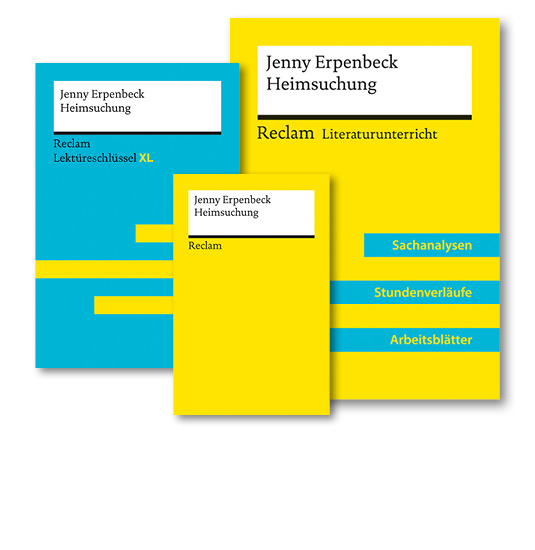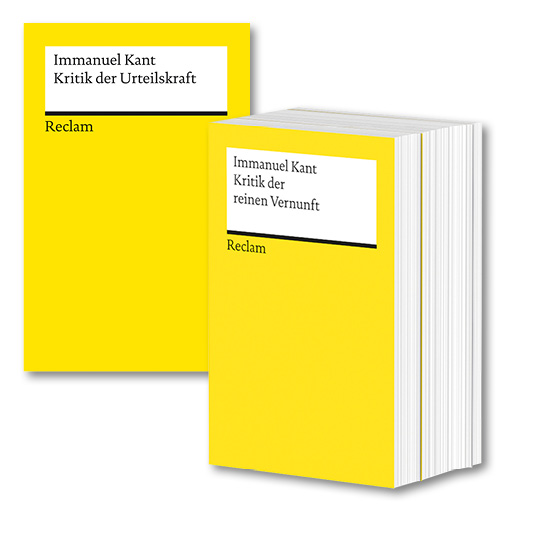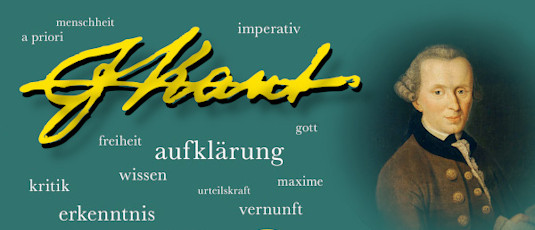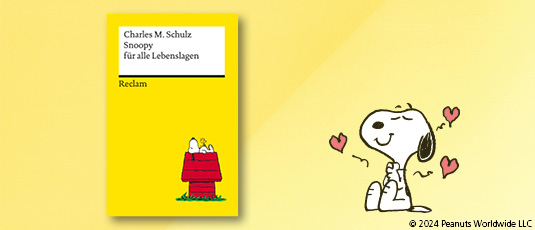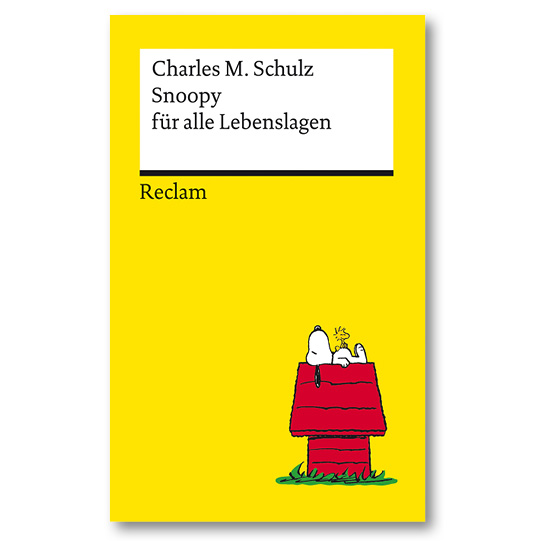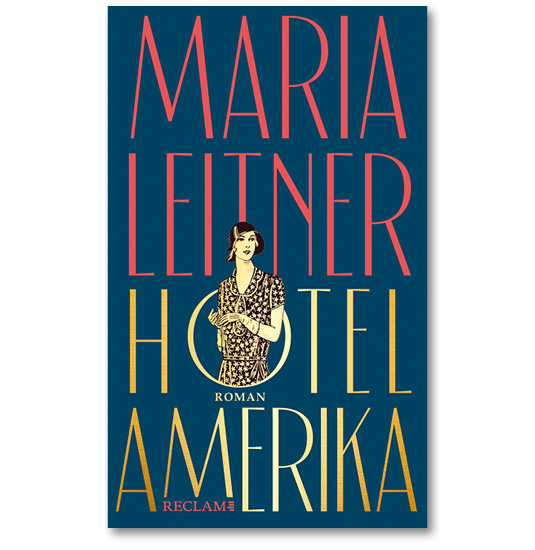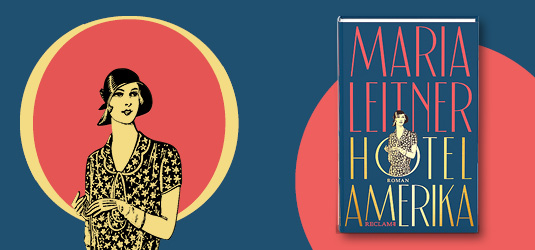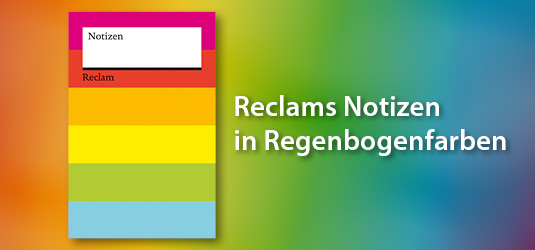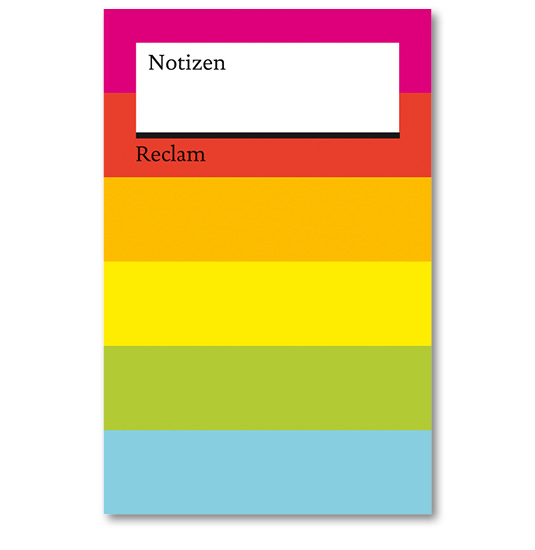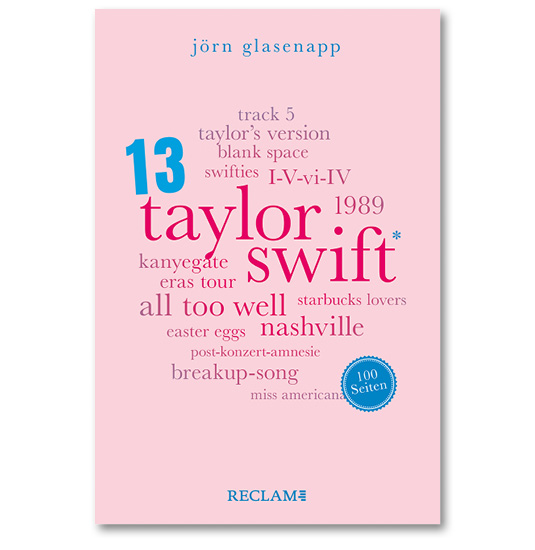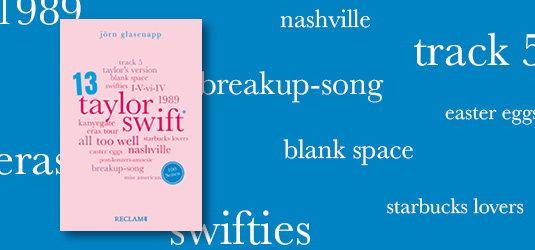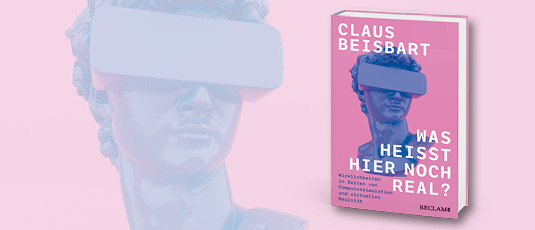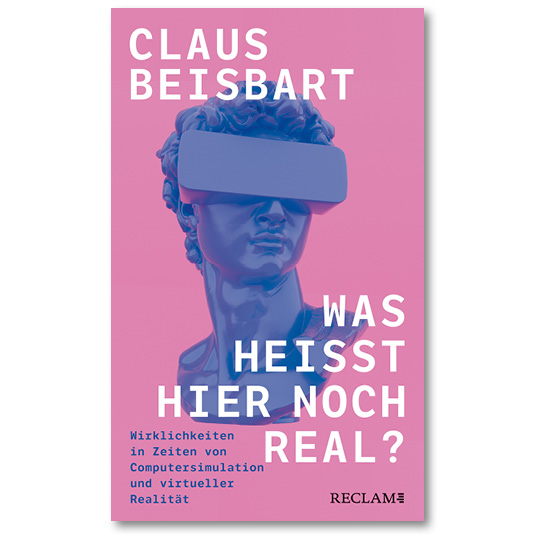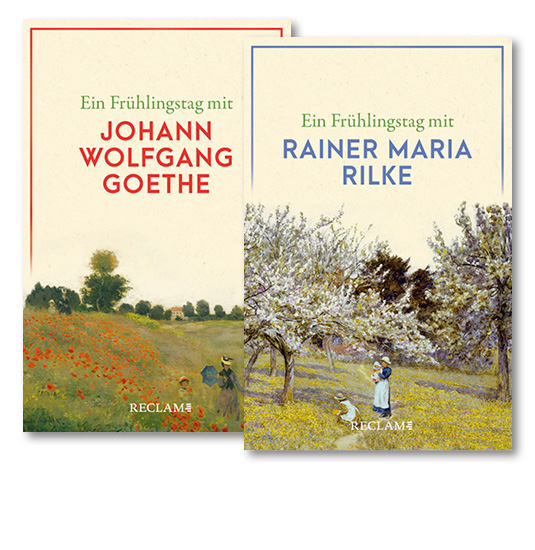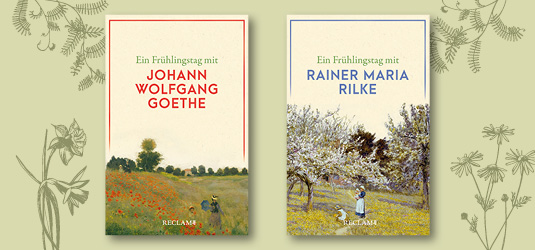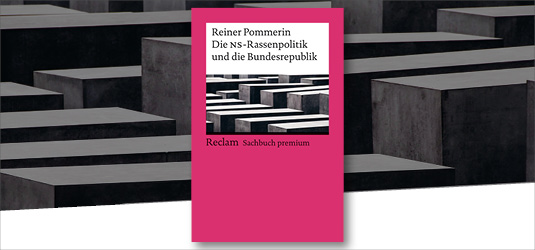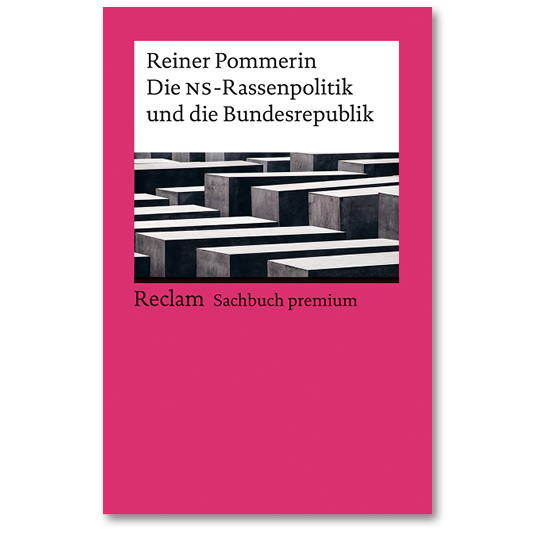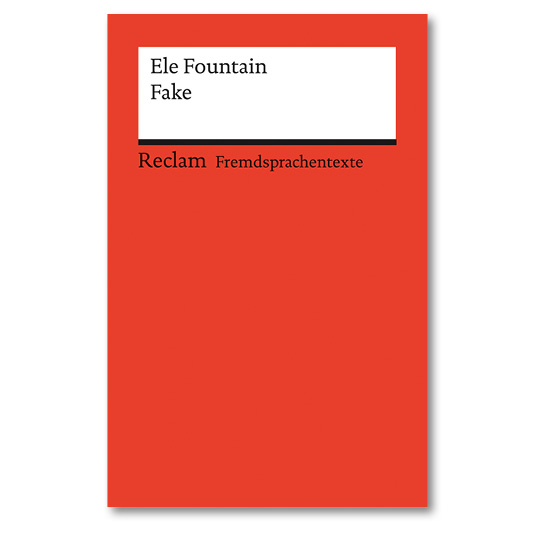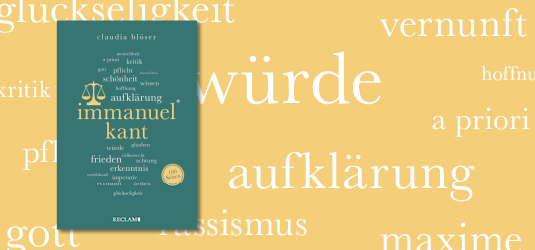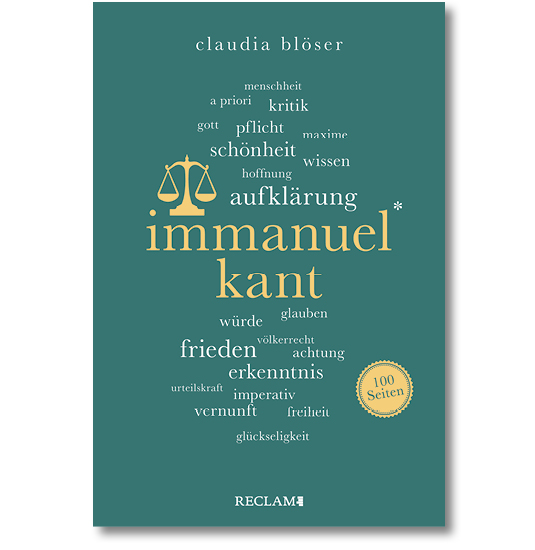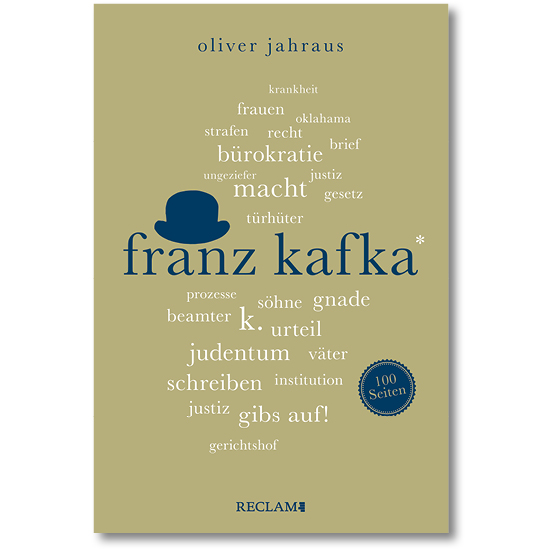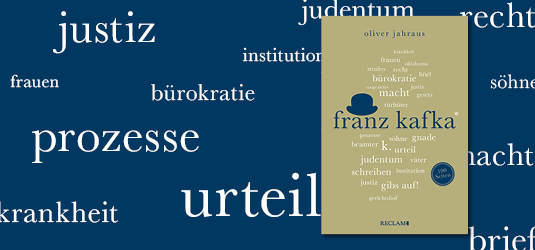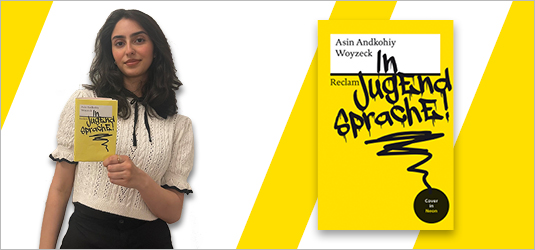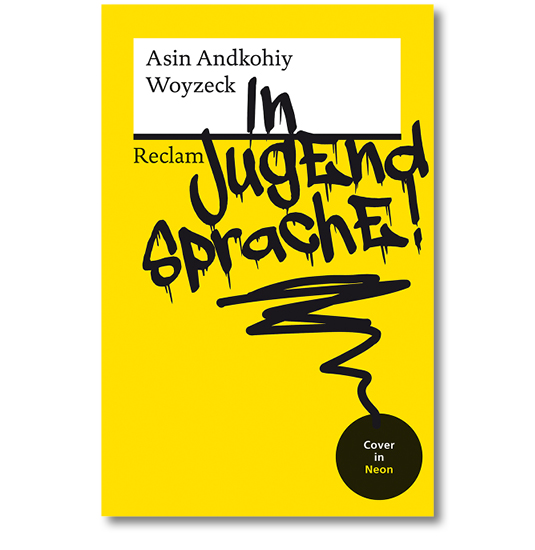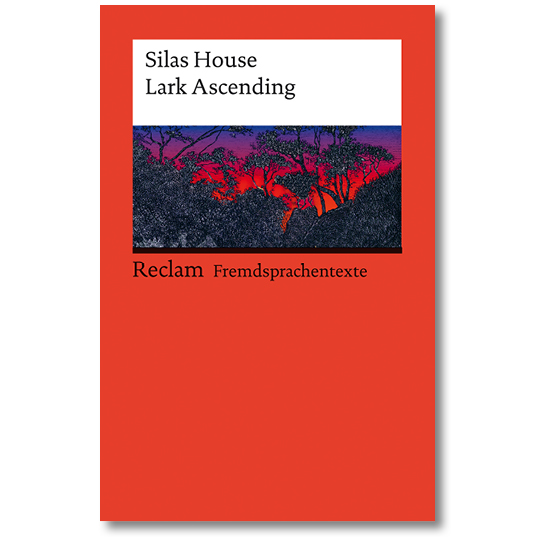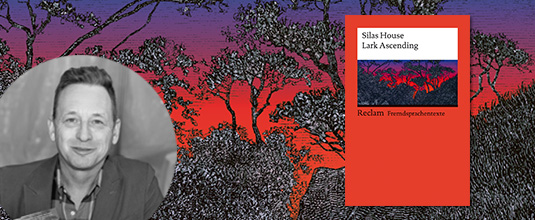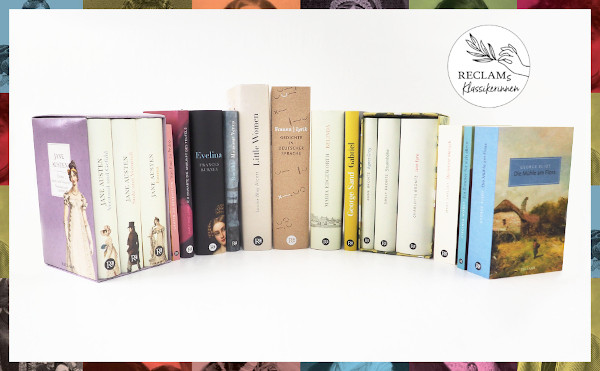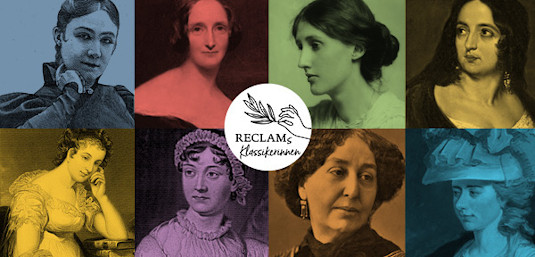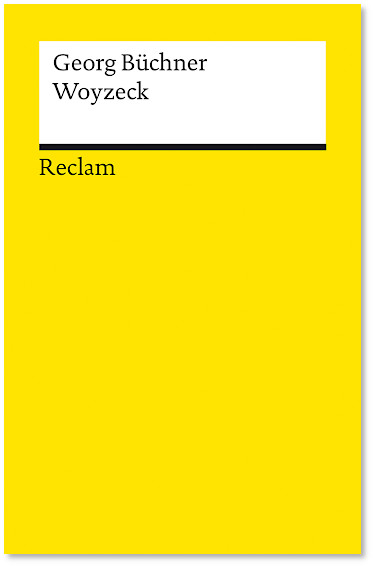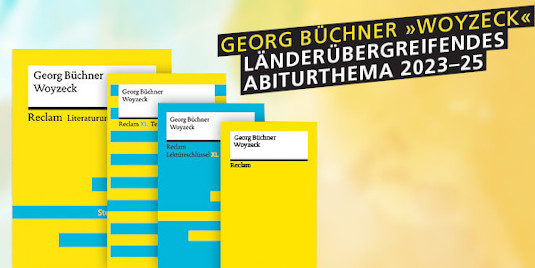Ausgewählte Neuheiten

EUR (D): 5,00

EUR (D): 8,00
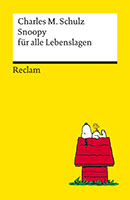
EUR (D): 7,00
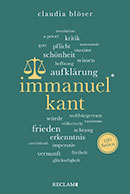
EUR (D): 12,00
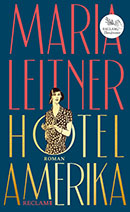
EUR (D): 25,00

EUR (D): 22,00

EUR (D): 7,40

EUR (D): 12,00

EUR (D): 12,00