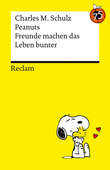Große Ambivalenzen in Leben und Werk
Das Werk von Charles M. (M. steht für Monroe) Schulz besteht scheinbar größtenteils aus harmlosen, witzigen Bilderstreifen, Comic Strips, in denen sich kleine lustige Figuren – gemeint sind vor allem die Peanuts – miteinander austauschen. Doch ein genauerer Blick zeigt uns, dass das Harmlose, Lustige, Witzige eine immense philosophische Dimension hat, denn diese Figuren, allen voran Charlie Brown und dann auch sein Hund Snoopy, und später all die anderen Figuren, die die Gruppe der Peanuts immer größer und vielgestaltiger machen, sprechen die großen Probleme an und erleben die wahre Tiefendimension menschlicher Existenz. Zwischen kindlicher Sorglosigkeit und ihren existenziellen Sorgen pflegen sie ihres Spleens, entwickeln ihr Profil sowie ihren Charakter und sind doch immer auch bedroht vom großen Unglück der Einsamkeit und Verzweiflung, sie kämpfen um Anerkennung, Freundschaft und Liebe und geben die Hoffnung (auf den großen Kürbis) nie auf, dass ihnen ein gutes Leben glücken kann.
Eine scheinbar unscheinbare Biografie
Dieselbe Ambivalenz, dasselbe Spannungsverhältnis kennzeichnet das Leben von Charles M. Schulz. Ein fleißiger Arbeiter und Familienmensch und zugleich ein begnadeter Zeichner sowie der geniale Erfinder eines ganzen Universums. Als Sohn deutschstämmiger Eltern am 26. November 1922 geboren, führte er tatsächlich ein unscheinbares Leben. Sein Lebenslauf gleicht dem vieler anderer amerikanischer Männer im 20. Jahrhundert. 1943 wurde er zur US-Armee eingezogen und war in Europa im Kriegseinsatz. Nach dem Krieg arbeitete er in einem Verlagshaus und kam dabei mit Comics in Kontakt. Zunächst bestand seine Aufgabe im Lettering, also im Ausfüllen von Sprechblasen, aber schon bald entdeckte er sein zeichnerisches Talent und begann, lustige Comic Strips über kleine Leute zu schreiben. Die Li’l Folks waren geboren und wurden zu den Vorläufern der Peanuts. Der erste Peanuts-Strip, in dem nur Charlie Brown namentlich auftaucht, erschien am 2. Oktober 1950. Die ersten Strips konnten an einige wenige Zeitungen verkauft werden. Doch Schulz hatte seine Beschäftigung fürs Leben gefunden. Und so konnte er daran denken, eine Familie zu gründen. 1951 heiratete er ein erstes Mal. Aus dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor. Die Ehe selbst wurde 1972 geschieden. Ein Jahr später heiratete Schulz ein zweites Mal. An den Peanuts arbeitete er Tag für Tag bis zu seinem Tod am 12. Februar 2000. Ein unauffälliges Leben, wenn auch mit dem großen Glücksfall, das eigene Talent, das eigene Potenzial, die eigene Berufung zu seinem Beruf machen zu können, den Schulz dann auch mit einem unglaublichen, geradezu protestantischen Arbeitsethos erfüllte: Er zeichnete für jeden Tag des Jahres einen Strip, einen Daily Strip mit meist vier Bildern für die Wochentage, mit mehr Bildern für den Sunday Strip – und das 50 Jahre lang bis zu seinem Tod. Es sind insgesamt ca. 17.800 Strips. Schulz wandte sich nach dem Krieg wieder der Religion zu und hat wohl im protestantischen Kontext auch selbst gepredigt. Dieses soziokulturelle Umfeld, aus dem eine solche Biographie entspringt, findet sich in den Peanuts wieder. Auch hier spielen die Geschichten in einer wohlbehüteten, bürgerlichen Vorstadt-Welt, in denen die großen gesellschaftlichen Verwerfungen (Krieg, Rassismus, Politik, ökonomische Krisen) bestenfalls am Rande auftauchen, dafür aber die existenziellen Fragen umso deutlicher im Vordergrund stehen. Man muss sie nur hinter der harmlosen Fassade entdecken wollen.
Ein geniales Werk
Der Erfolg der Peanuts war – gerade auch deswegen – unglaublich. War die Zahl der Zeitschriften, in denen Schulz seine Peanuts unterbringen konnte, zu Beginn sehr überschaubar, hat er auf dem Höhepunkt seiner Karriere tausende von Zeitschriften versorgt und Abermillionen von Leserinnen und Lesern erreicht. Dieser Erfolg war nur möglich, weil Schulz etwas Geniales gelungen war. Er hat einen eigentümlichen Zeichenstil entwickelt, der die Figuren mit kleinen Körpern und großen Köpfen zeigte. Sie sahen (entfernt) aus wie Erdnüsse, Peanuts, und bekamen so ihren Namen, was übrigens Schulz nicht glücklich machte. Ein Verleger hatte diesen Namen durchgesetzt, aber immerhin, er wurde ein Markenzeichen. Dieser Stil erlaubte es Schulz, seine Figuren mit einem beeindruckenden gestischen und mimischen Ausdruckspotenzial auszustatten, was es uns Leserinnen und Lesern leichter macht, die Tiefendimension ihrer existenziellen Hoffnungen und Sorgen, Freuden und Ängste, Höhen und Tiefen besser ermessen zu können. Man denke nur an das mal große, mal kurze, mal verschwundene Maul (sorry) von Snoopy. So werden die Peanuts und allen voran Charlie Brown und Snoopy zu großen Identifikationsfiguren. Schulz sagt es uns allen: “Of all the Charlie Browns in the world, you're the Charlie Brownest.”
Leben und Werk als Einheit
Doch so unscheinbar ist diese Biografie nicht. In dem Maße, wie sich das Peanuts-Universum entwickelte, in dem Maße sehen wir hier ein Genie am Werk, das in seinem Werk aufging. Ein deutlicher Hinweis ist nicht nur der Erfolg, sondern auch – damit direkt zusammenhängend – der Eifer, mit denen Schulz Tag für Tag dieses Universum entfaltete. Einen weiteren Hinweis kann man den autobiographischen Elementen entnehmen, die Schulz seiner zentralen Figur, Charlie Brown, wenn auch bisweilen ironisch gebrochen, mit auf den Weg gab. Beispielsweise hatte Schulz wie Charlie Brown als Junge einen intelligenten Hund besessen; Schulz’ Vater war wie der von Charlie Brown, selbst wenn er nie im Bild erscheint, Friseur – was im Comic besonders tragisch für den Sohn Charlie ist, der ja bekanntermaßen nur ganz wenige Haare auf seinem runden Kopf hat. Was aber dieses Peanuts-Universum zu einem echten und wahrhaftigen Lebenswerk macht, das ist die Art und Weise, wie mit den Peanuts Leben und Werk parallelisiert und so nahezu ununterscheidbar werden.
Der letzte Strip: Abschied von den „Dear Friends“
Am Ende wird dies offenbar: Der letzte Strip erschien am 13. Februar 2000, genau einen Tag nach dem Tod von Schulz. Und dazu kommt noch, dass Schulz diesen letzten Strip, einen Sunday Strip, nutzte, um sich von seinen Leserinnen und Lesern und auch von seinen Herausgebern mit einem Brief, der in dem Strip abgedruckt ist und der mit der Anrede „Dear Friends“ beginnt, zu verabschieden. Mit dem Werk endet das Leben – das wusste Schulz und brachte es auch vor seinen Leserinnen und Lesern zum Ausdruck. Das dokumentiert in der Tat ein Lebenswerk, das nicht nur wegen seiner Genialität, seiner existenziellen Bedeutung, sondern auch wegen seiner biographischen Beglaubigung durch Charles M. Schulz bleiben wird.